Es war im Februar, als ich, beruflich und privat enttäuscht, beschloss, dass ich endlich mal wieder raus muss. Weg von allem und allen. Neue Impulse, Abenteuer und Zeit für mich. Ich tippte «Kameltrekking» in die Suchmaske ein. Aber erst, als ich unverhofft auf einer Seite landete, die einen Wüstenaufenthalt als Einsiedler bewarb, spürte ich, dass ich meine Reise gefunden habe. Oder sie mich.
Trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl beim Gedanken, 14 Nächte und 15 Tage alleine in der Wüste auf der ägyptischen Halbinsel Sinai zu verbringen, umgeben von giftigen Schlangen, Skorpionen und Terroristen, die sich angeblich manchmal dort verstecken. Um nicht plötzlich aus Angst einen Rückzieher zu machen, begann ich allen, ausser meiner Mutter – für sie blieb ich beim Kameltrekking – von meiner bevorstehenden Reise zu erzählen.
Plötzlich allein
Und nun stehe ich also da: Ganz alleine auf «meiner» Düne. Der Beduine Ibrahim und sein Kamel ziehen davon und schon bald kann ich sie nur noch als kleine, sich bewegende Punkte ausmachen, bevor sie hinter einer Geröllhalde verschwinden. Ich schleppe die Nahrungsvorräte und Wasserflaschen, die sie für mich hergebracht haben, unter den nächsten Felsvorsprung, um sie vor der Sonne zu schützen. An lauwarmes Wasser werde ich mich trotzdem gewöhnen müssen.

Blick von meiner Dachterrasse: Unten links im Schatten liegt meine Küche und davor auf der Düne mein Schlafplatz.
Stille und Leere senken sich über mich. Was für ein Kontrast zu Ägyptens Hauptstadt Kairo, wo ich die letzten zwei Wochen verbracht habe und die mit über 20 Millionen Einwohnern nie zur Ruhe kommt. Nach einer Weile, in der ich gar nicht recht wusste, was ich mit mir anfangen soll, beginne ich mein riesiges «Open-Air-Appartement» einzurichten.
Auf der Düne entsteht mein Tausend-Sterne-Hotel. Ich bilde einen Schutzkreis aus Steinen und breite darin eine dünne Matte, ein paar Decken und den Schlafsack aus. Etwas weiter oben, unter den farbigen Felsvorsprüngen errichte ich die Feuerstelle. Und 290 Schritte die Düne runter finde ich in einem kleinen Canyon ein paar versteckte Nischen, die sich als Bade- und Toilettenplatz eignen.

Mein Schlafplatz unter dem freien Himmel.
Beim Einrichten der Küche schlage ich meinen Kopf heftig an einem Felsvorsprung an. Ich nehme es als Weckruf, noch achtsamer zu sein. In der Wüste ist es wichtig, immer genau hinzuschauen, wo man hintritt oder sich abstützt, denn ein Skorpionstich oder ein Schlangenbiss können schmerzhaft oder gar tödlich sein.
Die Nadel im Sandhaufen
Später erkunde ich meine Umgebung und klettere über ein paar Steine zu einer Felskathedrale, wie ich sie fortan nennen werde. Eine grosse, offene Höhle, in der es nachmittags wunderbaren Schatten gibt.
Auf dem Rückweg lösen sich auf beiden Seiten die Sohlen der Sandalen. In meinem Gepäck suche ich nach einer Nadel und einem Stück Schnur, um die Sandalen in mühsamer Handarbeit wieder zusammenzuschustern. Irgendwann bricht die Nadel und fällt zu Boden. Ich habe noch nie nach der Nadel im Heuhaufen gesucht, im feinen Wüstensand ist es aber wohl nicht viel einfacher. Ich bin daher froh, als ich sie finde.
Das Glücksgefühl ist aber nur von kurzer Dauer. Als ich mich wieder aufrichte, stosse ich meinen Kopf ein weiteres Mal an einem Felsvorsprung. Der Schlag ist so heftig, dass ich zu Boden gehe. Ich fasse mit der Hand an den Kopf und stelle erleichtert fest, dass er nicht blutet. Aber schon bald bildet sich eine grosse Beule auf der Schädeldecke. Instinktiv will ich zum Smartphone greifen, um nachzulesen, ob und welche äusserlich nicht sichtbaren Auswirkungen ein solcher Schlag auf den Kopf haben kann. Doch hier draussen gibt es keinen Empfang, ich kann das Telefon also getrost in der Tasche lassen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als meine Empfindungen genau zu beobachten und zu hoffen, dass es bloss eine Beule und keine inneren Verletzungen sind. In diesem Moment steigen mir zum ersten Mal Tränen in die Augen. Ich frage mich, wie ich 15 Tage alleine überstehen soll, wenn schon nach wenigen Stunden nicht nur meine Sandalen kaputt sind, sondern auch mein Kopf havariert?

In der Wüste wird man kreativ: Ein Stück Schnur hält meine kaputten Sandalen zusammen.
Nach der ganzen Aufregung habe ich keine Lust mehr, Feuer zu machen, um darauf zu kochen. Ich bereite mir stattdessen einen einfachen Tomaten-Gurkensalat mit Limettensaft als Sauce zu. Sobald es eindunkelt, lege ich mich in meinen Schlafsack. Es ist Neumond und der Himmel klar. Schon bald wird die Venus sichtbar. Später erscheinen der Grosse Wagen und weitere Sternbilder am Himmelszelt. Mir wird bewusst, wie unbedeutend ich kleines Menschlein auf meiner Düne bin. Und trotzdem fühle ich mich beim Anblick der Sterne geborgen und schlafe schon bald ein.
Krieg oder Meteorit?
Ich weiss nicht, wie lange ich geschlafen habe, aber irgendwann schrecke ich hoch. Ein Riesenknall ist an meine Ohren gedrungen und hat meinen Körper durchgerüttelt. Mit weit aufgerissenen Augen schaue ich um mich, doch ich sehe nur schwarze Nacht. Mein erster Gedanke ist: «Jetzt geht es los.» Hat sich der seit April herrschende Krieg im Sudan in den vergangenen zwei Tagen, die wir bereits ohne jeglichen Kontakt zur Aussenwelt im Basislager verbracht haben, so schnell ausgebreitet? Oder ist an der nahen Grenze zu Israel etwas vorgefallen? Als dritte Erklärung kommt mir nur noch der Einschlag eines Meteoriten in den Sinn.
Nachdem wieder Stille eingekehrt ist und sich in meiner unmittelbaren Umgebung nichts zu rühren scheint, lege ich mich wieder hin und schlafe weiter. Am nächsten Morgen sieht alles noch genauso aus wie gestern. Ich frage mich, ob ich mir den Knall bloss eingebildet habe. Erst zwei Wochen später, nach der Rückkehr ins Basislager, erfahre ich, dass in jener Nacht irgendwo in der Wüste eine Sprengung stattgefunden hat. Sie war für meinen nächtlichen Schreck verantwortlich.
Notfallplan mit Lücken
In den nächsten Tagen entwickle ich eine Art Routine in meinem Wüstenalltag. Sobald es um etwa 5.30 Uhr hell wird, wache ich auf. Ich gehe hinunter in den Canyon, um mich mit ein wenig Wasser aus der Flasche zu waschen. Denn nach Nächten mit kräftigem Wind fühle ich mich wie ein paniertes Plätzchen.
Später spaziere ich zu einem markanten Stein, wo ich als Lebenszeichen einen von zwei aufeinandergetürmten Steinen auf die Seite legen soll. Der Beduine Ibrahim wird später eine Runde machen und die beiden Steine wieder aufeinanderlegen. Passiert mir auf dem Rückweg in mein Camp allerdings ein Unfall, würde es Ibrahim erst mehr als 24 Stunden später bemerken. Diesen Gedanken verdränge ich gleich wieder, genauso wie die Frage, was ich machen würde, wenn morgen die Steine immer noch nebeneinander liegen würden. Das würde bedeuten, dass im Basiscamp etwas vorgefallen ist. Sollte ich dann dorthin zurückkehren und so vielleicht in eine Falle tappen? Oder doch eher versuchen, mich möglichst still und unsichtbar zu verhalten?
Ich lerne schnell, mich nicht mit solchen Gedanken aufzuhalten, sondern mich auf den Moment zu konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser Horrorszenarien eintrifft, dürfte klein sein. Und wenn, ist es dann noch früh genug, sich damit zu befassen. So komme ich immer mehr zur Ruhe und fange an zu geniessen. Die Sandalen sind mittlerweile notdürftig geflickt und die Küche mitsamt Feuerstelle habe ich an einen anderen Platz verlegt, wo ich nicht Gefahr laufe, meinen Schädel nochmals einzuschlagen.
Die Sinne schärfen sich
Den Morgen verbringe ich meistens in der Küche, weil es der einzige Ort ist, wo es um diese Tageszeit schon ein bisschen Schatten gibt. Am Nachmittag begebe ich mich in die Felskathedrale am Ende des Canyons. Und manchmal wandere ich am Abend aufs Hochplateau, um den Weitblick ins nächste Tal zu geniessen.

Blick vom Hochplateau ins nächste Tal im Abendlicht.

Das grosse Nichts: Stein und Sand soweit das Auge reicht.
Im grossen Nichts und der absoluten Stille sehe und höre ich plötzlich viel mehr als üblich. Selbst aus dem Augenwinkel heraus nehme ich kleinste Bewegungen und Veränderungen wahr. Wie die Eidechse, die aus einer Ritze späht. Und nach ein paar Tagen höre ich immer öfter ein gleichmässiges Brummen. Mehrere Leute, denen ich später davon erzähle, meinen, das sei der Ton der Erde. Wissenschaftler hingegen sagen, dass die Frequenz der Erde für Menschen nicht hörbar sei. Egal was es ist, für mich wird dieser Ton zu einem beruhigenden Begleiter in der Einsamkeit.
Ich beobachte die verschiedenen Käfer, Ameisen und Eidechsen in allen möglichen Formen und Farben. Von den Eidechsen lerne ich das Stillsitzen, die silbernen Ameisen faszinieren mich mit ihrem Teamwork. Und die Schmetterlinge erfreuen und verwundern mich. Wovon leben sie hier?
Ich sammle Steine, die eine Farbintensität und Leuchtkraft aufweisen, die ich so noch nie zuvor gesehen habe. Das tiefe Blau meines Lieblingssteins leuchtet selbst in der Nacht.

Ein kleiner Vogel hat sich in einer Felsnische niedergelassen.
«Es wird alles so simpel und gleichzeitig intensiver.»
Weil jegliche Ablenkung fehlt, mache ich alles bewusster. Wenn ich Gemüse rüste, rüste ich Gemüse und höre nicht nebenbei noch einen Podcast in doppelter Geschwindigkeit. Plötzlich nehme ich dabei das Gemüse nicht nur über die Augen wahr, sondern ich fühle die kleine Narbe an der Oberfläche der Gurke, rieche die Tomate und höre das Messer, wenn ich damit die Kartoffeln schneide. Wenn ich esse, esse ich, ohne gleichzeitig die Zeitung zu lesen. Und wenn ich die Düne hinuntergehe, nehme ich jeden Schritt einzeln wahr, anstatt dabei noch eine Nachricht auf dem Smartphone zu verschicken. Es wird alles so simpel und doch irgendwie intensiver als sonst.

Kochen über dem Feuer: Ein Steckchen dient mir als Deckelhalter.
Nach sieben Tagen kommt Ibrahim vorbei und bringt mir Wassernachschub und ein paar weitere Kartoffeln und Zwiebeln. Mir wird bewusst, dass die Hälfte meiner Zeit als Einsiedlerin in der Wüste bereits abgelaufen ist. Kurz kommt das beunruhigende Gefühl hoch, dass ich meine Zeit hier bisher verschwendet habe. Denn von den Fragen, die mich überhaupt erst hierhergeführt haben, habe ich noch keine beantwortet. Ich habe noch nicht einmal über sie nachgedacht. Das Zuhause, die Arbeit und die Menschen in der Schweiz sind weit weg. Nach einer Weile begreife ich, dass vielleicht genau das der Sinn dieser Reise ist. Endlich wieder bei mir und im Moment anzukommen. Dann werden sich die Antworten auf meine Fragen zu gegebener Zeit von selbst ergeben.
Grossartiges Kino
Am neunten Tag ist es bedeckt und zwischendurch fallen sogar ein paar Regentropfen. Als sich der Himmel gegen Abend immer mehr verfinstert, zügle ich mein Bett vorsorglich unter die Felsvorsprünge in der Küche. Bald zucken erste Blitze am Himmel. Ich ziehe die Armreifen aus und verstecke sie zusammen mit Kochtopf, Teekrug und Besteck hinter einem grossen Stein.
«Ich zucke jedes Mal von Panik ergriffen zusammen
und bin gleichzeitig fasziniert
von diesem grandiosen Naturschauspiel.»
Als Blitz und Donner immer näher aufeinander folgen, kriege ich es mit der Angst zu tun. Dass sich irgendwann das in Felsspalten angesammelte Wasser direkt über meinem Schlafsack entleert, kommt mir in diesem Moment wie eine nebensächliche Bagatelle vor. Die Blitze lassen die hellen Steinschichten in der schwarzen Nacht aufleuchten und der Donner hallt von den Wänden des Felskessels wider. Ich zucke jedes Mal von Panik ergriffen zusammen und kann mir ein «Wow, grossartiges Kino» trotzdem nicht verkneifen.
Irgendwann zieht das Gewitter weiter und ich schlafe erschöpft ein. Am nächsten Tag scheint wieder die Sonne und trocknet meinen nassen Schlafsack im Nu. Ich selbst brauche länger, um mich von der angsterfüllten Nacht zu erholen. Ich spüre eine Unruhe in mir und um mich herum. Zahnstocherspitzengrosse Punkte bewegen sich auf der anderen Seite des Talkessels. Wahrscheinlich ein paar Beduinen auf dem Weg zu einem frisch gefüllten Wasserloch. Später fährt ein weisser Pick-up auf mein Lager zu. Ich bleibe im Schatten eines Felsvorsprungs sitzen und bin froh, als er vielleicht 100 Meter vor meinem Schlafplatz in eine andere Richtung abdreht. Doch die Unruhe bleibt und sie wird nicht kleiner, als ich beim Einschlafen nochmals den Kopf hebe und weit entfernt ein paar Scheinwerferpaare durch die Wüste ruckeln sehe.
Nachts kommen Ängste hoch
Nach zwei unruhigen Nächten schlafe ich in der nächsten Nacht endlich wieder tief und fest. Wenn ich zwischendurch erwache, schaue ich zum Himmel hoch und kann anhand der Position des grossen Wagens inzwischen halbwegs genau die Uhrzeit schätzen. Ich fühle mich wieder im Lot.

Der Fels ist sehr brüchig und bringt wunderbare Formationen hervor.
Doch als ich am nächsten Morgen zum Platz gehe, wo ich das Lebenszeichen hinterlasse, erwartet mich dort eine Nachricht von Sabera, die die Reise organisiert. Sie schreibt, dass ich die Augen weiterhin offen halten soll. An ihrem Platz sei eine Sandviper aufgetaucht. Ich wünschte, ich hätte diese Nachricht nicht erhalten. Denn als ich mich zu dieser Reise anmeldete, war meine Angst vor Schlangen die Grösste. Sie ist aber nebst all den anderen Herausforderungen, die sich mir hier gestellt haben, bald in den Hintergrund gerückt. Die Moskitos, die mich nachts auffressen, stellten sich schnell als die viel lästigeren Tiere heraus. Doch nun sind die Schlangen zurück in meinen Gedanken. Saberas Tipp für eine allfällige Begegnung mit einer Schlange ist nur sehr vage: Vertraue deiner Intuition, dann wirst du schon richtig handeln.
Mit ein paar Entspannungsübungen versuche ich mich zu beruhigen. Doch nachts überkommt mich die Angst. Zumindest ist das meine Erklärung dafür, dass ich dreimal mit Herzrasen aufwache und beim dritten Mal zusätzlich ein Zucken im Kopf verspüre. Selten war ich so froh, dass es irgendwann wieder Tag wurde.
«Es ist die erste menschliche Stimme ausser meiner eigenen, die ich seit 13 Tagen höre. Ich kriege Gänsehaut»
Nach all den Ereignissen der letzten Tage fange ich an, die Nächte zu zählen, die ich noch alleine hier draussen verbringen muss. Nur noch zwei: Das schaffe ich. Und tatsächlich wird die nächste Nacht sehr entspannt und ruhig. Der Himmel ist klar, die Sterne leuchten. Für diesen Moment habe ich einen einzigen Song auf meinem Telefon gespeichert, bevor ich die Reise antrat. Jetzt stecke ich die Kopfhörer ein und drehe die Lautstärke auf. Xavier Rudds «Spirit Bird» erklingt. Es ist die erste menschliche Stimme ausser meiner eigenen, die ich seit 13 Tagen höre. Ich kriege Gänsehaut.
Am nächsten Morgen entdecke ich nebst den üblichen Mäuse-, Eidechsen- und Käferspuren zum ersten Mal auch Schlangenspuren in meiner Küche. Muss das nun auch noch sein? Ich mache ein Foto mit dem Smartphone und wandere zu einem erhöhten Aussichtspunkt. Als ich Ibrahim auf seiner täglichen Runde entdecke, laufe ich schnell hinunter und zeige ihm die Fotos. Daraufhin begleitet er mich in mein Camp und schaut sich die Spuren vor Ort an. Schliesslich meint er: «Small snake, no problem.» Mit dem Finger zeichnet er eine etwas dickere S-Linie in den Sand und sagt: «this snake problem.» Und schon verschwindet er wieder. Nun, er wird es wohl wissen. Ich setze mich erst mal hin, entfache ein Feuer und trinke Tee.
Morgen ist der Auszug. Ich fange bereits an, ein paar Sachen einzupacken. Plötzlich merke ich, dass das Brummen verschwunden ist. Dieser vermeintliche Ton der Erde, der mich all diese Tage begleitet hat. Es scheint, als wäre ich im Geist schon wieder weg und daher nicht mehr fähig, diesen Ton zu empfangen.
Tränen zum Abschied
Am Abend zieht plötzlich eine graue Wand auf und hüllt alles ein. Auch da scheint es, als hätten sich die Wüste und die Sterne schon frühzeitig verabschiedet. Immerhin bleibt ein erneutes Gewitter aus und ich muss nicht zur Schlange in die Küche ziehen.

Nach 15 Tagen Isolation in der Wüste treffe ich wieder auf meine Mitstreiter. Gemeinsam verlassen wir die Wüste zu Fuss.
An meinem letzten Morgen kommen Bilder und Gefühle aus den vergangenen zwei Wochen hoch. Die schönen, freien Momente und die schwierigen Momente voller Angst. Und dann lässt die Anspannung nach und ich fange an zu weinen. Ich weine aus Freude, weil ich es geschafft und bis zum Ende durchgezogen habe. Weil ich weiss, dass ich in Zukunft Stärke aus dieser Erfahrung werde ziehen können. Ich weine aber auch, weil ich daran denke, was mich überhaupt erst in die zum Teil unangenehmen Situationen gebracht hat. Ich bin diese Reise als Selbstexperiment angegangen und sie hat mir definitiv meine Grenzen aufgezeigt. Die Reise hat mich aber auch gelehrt, wie man bewusster leben kann. Für diese Erfahrung bin ich dankbar.
Beim Frühstück entdecke ich neue Spuren der kleinen Schlange. Auch wenn sie scheinbar keine Gefahr ist, bin ich nicht traurig, auszuziehen und den Platz ganz ihr zu überlassen. Nach dem Mittag laufe ich los. Überquere den Talkessel und bin erstaunt, wie hügelig es ist. Von meinem Platz aus hat alles so flach ausgesehen, doch in Wirklichkeit ist die Ebene von vielen Canyons durchschnitten. Vor dem Übergang ins Basiscamp drehe ich mich nochmals um, doch aus der Ferne habe ich bereits Mühe, mein Daheim der letzten zwei Wochen auszumachen. Im Herz werde ich diesen speziellen Ort aber immer bei mir tragen.
Bieler Tagblatt, 06. September 2023
Text und Bilder: Carole Lauener

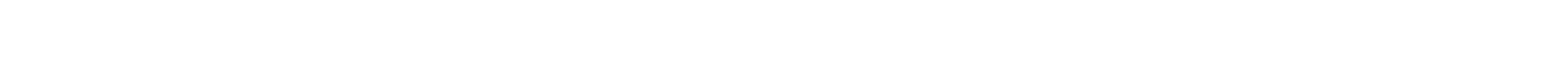






Leave a reply